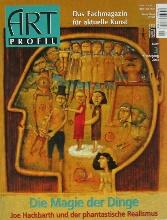 |
ART PROFIL HEFT 3 / 9.JAHRGANG 2003 |
|
Ein dialogischer Prozess mit dem Betrachter und mit dem eigenen SchaffenViorel
Chirea und seine Bilder Der
Maler Viorel Chirea wurde im Jahr 1960 in Rumänien geboren. Er besuchte
dort ein Gymnasium für künstlerisch hochbegabte Schüler. Damit war
sein beruflicher Entwicklungsweg vorgezeichnet. Nach dem Abitur
studierte er an der Kunstakademie in Bukarest und wurde schließlich in
den Berufsverband der Bildenden Künstler Rumäniens aufgenommen. Diese
Mitgliedschaft war im damaligen Rumänien unabdingbar, um überhaupt als
Künstler anerkannt zu werden, öffentliche Aufträge zu erhalten und an
großen Kunstausstellungen teilnehmen zu können. Chireas Werke waren ab Mitte der 80er Jahre bei landesweiten Ausstellungen zu sehen. Durch diesen Ausweis der künstlerischen Qualität gehörte er zur künstlerischen Elite jenes Landes. Sein Schaffen wurden von der Kunstkritik wahrgenommen. Er fand Eingang in staatliche Kunstsammlungen und Museen. Nach
der Revolution von 1989 kehrte Viorel Chirea Rumänien den Rücken und
ließ sich in Deutschland nieder. Heute lebt der Künstler in Aachen.
Sein jetziges Atelier
beherbergte einst eine international bekannte Kunstgalerie. Das Prädikatssiegel,
die gesprayte Banane, zeugt davon wie angesehen diese Galerie im
schnelllebigen Kunstgeschäft einst gewesen ist. Aber auch Chireas
Schaffen hat eine gesprayte Banane verdient und so steht das Prädikatssiegel
auch nach dem Auszug der Galerie, zu Recht am
Eingangsportal. Viorel Chirea gelang es relativ rasch, in seiner neuen Heimat Fuß zu fassen und sich an die weitaus komplizierteren Bedingungen der westlichen Wirtschaft und der Kunstvermarktung zu gewöhnen. Unvorstellbar, wenn man sich die unsichere Situation der meisten Kunstschaffenden im Westen vor Augen hält. In Rumänien hatte der Künstler gegenüber seinen Kollegen in anderen Ostblockländern noch zusätzlich den Vorteil, dass es relativ frei von staatlicher Bevormundung arbeiten konnte. Es gab keine Kunstdiktatur wie in der DDR, wo sich der Künstler an den „Sozialistischen Realismus“ zu halten hatte. Die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Kunst wurden nicht sanktioniert. Es gab Abstrakte, Informelle und Avantgardisten, denn Rumänien war trotz der wirtschaftlichen Armut ein kulturell hoch entwickeltes Land, das auf eine reiche künstlerische Vergangenheit zurückblicken konnte. Die kulturelle Verbindung zu den romanischen Ländern, vor allem zu Frankreich, und die außenpolitische Offenheit dem Westen gegenüber, machte es möglich, dass die Künstler, sofern sie sich nicht gegen die Staatsideologie auflehnten, größere Entfaltungsspielräume besaßen. Die
rumänischen Kulturschaffenden konnten verhältnismäßig leicht in
westlichen Ländern ausreisen und dort ihre Erfahrungen sammeln. So kam
es, dass für die meisten Künstler jenes Landes die Revolution von 1989
nicht unbedingt mit einem stilistischen Neuanfang gleichzusetzen ist.
Dies war auch bei Viorel Chirea nicht der Fall. Obwohl
er sich in dieser Hinsicht treu geblieben ist, hatten allerdings die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kunstproduktion im Westen einen
unmittelbaren Einfluss auf sein Schaffen. Dieser Einfluss wird
offensichtlich, wenn man sich Chireas künstlerische Vita genauer
anschaut. Zwischen 1990 und 2000 stellte er nur noch sehr selten aus. Er
arbeitete in dieser Zeit hauptsächlich als Graphiker, um sich seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Erst Ende der 90er Jahre trat er wieder
mit eigenen Bildern hervor. Im Jahr 2001 zeigte die Galerie Laïk in
Koblenz in einer Einzelausstellung seine Werke. Durch diese renommierte
Galerie war er auch auf internationalen Kunstmessen vertreten. Bei
meinem Besuch in Aachen bereitete Chirea gerade eine Ausstellung in der
Schweiz vor. Inhaltlich
sind Chireas Bilder vieldeutig und deshalb schwer zu interpretieren.
Konstituierend ist dabei der dialogische Prozess, durch den er sich
immer wieder auf sein
bisheriges Schaffen bezieht. Dies wird vor allem in seinen jüngsten
Werken offensichtlich. Er begnügt sich dabei nicht mit einem einmal
erreichten Zustand, sondern überarbeitet Bilder immer wieder. So
zieht sich der Malprozess an einem Werk manchmal über Wochen und Monate
hin. „Ich werde mit einem Bild eigentlich nie fertig“, bekennt er
selbstironisch. „So lange es in meinem Atelier ist, habe ich Lust,
daran weiter zu arbeiten.“ Mit
dieser Beschreibung trifft der Künstler den Kern seiner prozesshaften
Malerei, bei dem ein Bild sich als das Element eines kontinuierlichen
Flusses erweist, sehr genau. In einem Bild, so scheint es, ist der Strom
der Geschichten und Ideen, der sich in den sedimentartigen Ablagerungen
auf der Leinwand ausdrückt, für einen Moment angehalten und geronnen.
Chirea scheint es dabei weniger um
ein einzelnes, isoliertes Werk als solches zu gehen, sondern vielmehr um
den Zyklus, bei dem sich die Wirkung über die Bildfläche hinaus
fortsetzen lässt. Die Bildformen, die der Künstler wählt, unterstützen
diese eben beschriebene Wirkung. Ditychen, Tritychen und Poliptychen
sind keine Seltenheit. Neu
sind Rundbilder, wie sie von der Renaissance und der Barockzeit her
bekannt sind. Solche Formen haben für Chirea nicht nur Bedeutung als
kunstgeschichtliches Zitat, sondern auch als inhaltliche Komponente. Er
geht ihm offenkundig darum, auf diese Weise die Möglichkeiten seiner
Gestaltungsfreiheit spielerisch auszuloten, immer wieder bereit, das
eigene Schaffen kritisch zu hinterfragen und neu zu beginnen. Bei
Chireas Bilder dominieren häufig erdige Grundtöne. Er sucht dabei
bewusst die Nähe zu verwittertem Graffitti oder zur Frescomalerei und
anderen Zeugnissen von künstlerischen Spuren, die durch die Zeit und
durch die Wirkung der Elemente angegriffen wurden. Der Betrachter
erkennt Andeutungen von Landschaften, silhouttenhafte Figuren,
kalligraphische Züge, Körperlinien und Interieurs, die sich in einem
unterschiedlichen Grad der Deutlichkeit auf der Leinwand verdichten.
Wird eine Form dabei allzu klar, so wird sie im folgenden Arbeitsprozess
verwischt, verfremden und in dieser verwandelten Form neu in das
Gesamtbild integriert. Obwohl es auf den ersten Blick so scheint als
verlasse sich Chirea hier ganz auf den Zufall, so folgt er dabei doch
einer inneren Notwendigkeit. |
|