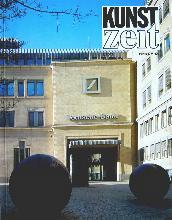 |
KUNSTzeit HEFT 1 / 2001 |
|
Viorel Chirea
Irritierende Begegnung auf der Leinwand
von
Jutta Göricke Aus
den 30-er Jahren ist folgender Dialog zwischen Andre’ Masson und Henri
Matisse überliefert: Masson
sagte: "Ich fange ohne (...) Plan (...) an und zeichne oder male
nur schnell nach meinen Impulsen. Nach und nach sehe ich in den Spuren,
die ich hinterlasse, Andeutungen von Figuren oder Gegenständen, ich
ermutige sie, stärker hervorzutreten, will ihre Implikationen herausarbeiten,
genau wie ich jetzt bewusst versuche, die Komposition zu ordnen." Masson und Matisse beschreiben hier exemplarisch
die Arbeitsweisen der zwei großen Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts,
deren Exponenten sie sind. Die der surrealistischen ecriture automatique,
die sich des Unbewussten als Reservoir bedient, ihren Bildgegenstand im
Entstehen erfindet und schließlich zu den "Stimmungszeichen"
der Abstrakten Expressionisten und des Informel führt. Und die
Arbeitsmethode der abstrakten Malerei, die von einem objektiven, äußeren
Gegenüber ausgehend, Abbilder schafft, wobei die mangelnde ähnlichkeit
dieser Abbilder mit ihren Vorbildern darauf beruht, dass nicht mehr das
Postulat der Mimesis gilt, sondern die "Totalität der
Wahrnehmung", wie beispielsweise Paul Klee formuliert hat. Der
rumänische Maler Viorel Chirea präsentiert dem Betrachter am Ende
des Jahrhunderts seine Bilder, die mit dem Antagonismus von
ecriture automatique und abstrakter Malerei spielen. Thematisch lassen
sich die Gemälde, die fast alle aus den Jahren 1999/01 stammen, in drei
Werkgruppen fassen. Doch
nicht nur das Gegensatzpaar abstrakt/amorph und die Farbkontraste, deren
Einsatz für Chirea auf der Auseinandersetzung mit der Farbtheorie von
Josef Albers basiert, spielen eine Rolle. Zu seinen Materialien gehören
vor allem Gedankenzeichnungen aus feinen Linien, die auf die Materialität
von Farbflächen treffen. So stören aleatorische Bildelemente die
konstruktiven, amorphe werden durch geometrische diszipliniert. Der
Konfrontationskurs führt programmatisch dazu, dass es ständig zu
irritierenden Begegnungen auf der Bildfläche kommt. Von Elementen, die
oft widersprüchlich sind, sich gegenseitig in Frage stellen oder sich
in ihrer Bedeutung verstärken und dadurch das Bedeutungspotential des
Bildes vergrößern. Maßzahlen,
Koordinaten, geometrische Strecken stehen für Exaktheit und
konterkarieren pastose Farbflächen oder Skripturen, die nicht nur
Ausdruck spontaner Selbstnotiz sind, sondern auf Schriftkultur per se
anspielen. Dabei sei angemerkt, dass Chirea nicht etwa unleserlich
schreibt und zur Entzifferung von Wörtern oder Sätzen aufruft. Seine
Skripturen haben keine Bedeutung außer der, graphische Elemente zu
repräsentieren. Zitate
aus der Kunstgeschichte sollen an das kulturelle Gedächtnis des
Betrachters appellieren und so den Horizont über die Bildebene hinaus
erweitern: zum Beispiel die Anleihen an die fragilen Raumkonstruktionen
von Francis Bacon, die Figurinen von Oskar Schlemmer oder die
Spiegelschrift und kleinen Konstruktionszeichnungen aus Leonardos
Codices. Abklatschverfahren erzeugen
hyperrealistische Bildstrukturen die im Bildkontext wie ein trompe d'oeil
wirken und damit einen Höhepunkt mimetischer Tradition zitieren - und
stehen doch zugleich für ihre
automatistische Herkunft. Darüber
hinaus verweisen palimpsestartige übermalungen auf vergangene Bildzustände
und damit per se auf die Themen Zeit und Geschichte. Die
männlichen Akte sind nun kaum noch von den Bildern der zweiten
Werkgruppe zu unterscheiden, in denen Viorel Chirea auf den Körper als
Referenz verzichtet und nur noch abstrakte Elemente verarbeitet. Wieder
entstehen, je nach Lesart, Innenräume, Landschaften oder auch
Stilleben. Die Allansichtigkeit der Bilder erklärt im übrigen auch,
warum Viorel Chirea das quadratische Format bevorzugt. Sakralmystische
Assoziationen evozieren die Bilder der dritten Werkgruppe, in denen
Chirea mit Kupferblatt und in einer warmerdigen Farbigkeit arbeitet.
Dabei ist ihm wichtig, dass auch diese Bilder nichts anderes. als
Ergebnisse seiner kombinatorischen Arbeitsweise sind, daher den anderen
gleichwertig und nicht etwa metaphysisch aufzufassen sind, als
Fortsetzung osteuropäischer Ikonenmalerei. Viorel
Chirea behandelt seine Bildmaterialien vielmehr semiotisch: Jeder
Pinselstrich, jeder Buchstabe, jede Linie repräsentiert als Zeichen
sich selbst oder eine kulturelle Erinnerung. Im Extremfall: Das x, das als Platzhalter für einen Platzhalter
steht. Viorel
Chirea situiert sich mit seinen Bildern dezidiert als Vertreter einer
l'art pour l'art. Er zeigt, dass Kunst sich immer nur selbst repräsentieren
kann, und macht Kunst über Kunst. Dr. Jutta Göricke
ist Chefredakteurin des Aachener Stadtmagazins Klenkes und der
Zeitschrift "artefACt - Kunst im Westen". Die Autorin hat
zahlreiche kunsthistorische und kunstwissenschaftliche Aufsätze
publiziert. 1995 ist ihr Buch "Cy Twombly - Spurensuche" im
Silke Schreiber Verlag, München, erschienen. Sie ist Mitherausgeberin
des Titels "Erkenntnis. Erfindung. Konstruktion" , der Ende
2000 im Gebr. Mann Verlag, Berlin, herausgekommen ist. |
|